fair-fish. Billo Heinzpeter Studer
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу fair-fish - Billo Heinzpeter Studer страница 2
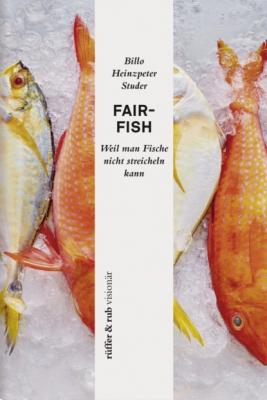 Kluft schlüpfen, an der Bootskante mit anfassen, hauruck, bis die Piroge vom Strand geschoben ist und schwimmt, und nix wie reinspringen und ab. Banda Diouf, der Capitaine dicht hinter mir, dreht den Motor auf und jagt die faltbootenge Piroge mit Höchstgeschwindigkeit aufs Meer hinaus. Als die hellen Scheinwerfer von Kayars großem Fischerhafen entschwinden, herrscht reine Nacht. Mit wem hock’ ich eigentlich im selben Boot?
Kluft schlüpfen, an der Bootskante mit anfassen, hauruck, bis die Piroge vom Strand geschoben ist und schwimmt, und nix wie reinspringen und ab. Banda Diouf, der Capitaine dicht hinter mir, dreht den Motor auf und jagt die faltbootenge Piroge mit Höchstgeschwindigkeit aufs Meer hinaus. Als die hellen Scheinwerfer von Kayars großem Fischerhafen entschwinden, herrscht reine Nacht. Mit wem hock’ ich eigentlich im selben Boot?
Ich klammere mich mit beiden Händen an Kanten, verkeile mich mit beiden Füßen gegen Spanten und bin vollauf damit beschäftigt, die heftigen Schläge der Wellen, die das Boot auf und ab und hin und her schütteln und, so fürchte ich, zum Kentern zu bringen drohen, durch ständiges Verlagern meines Gewichts auszugleichen. Bloß nicht rumrutschen! Was tut der Wahnsinnige da vor mir? Stellt sich aufrecht hin und … pinkelt, tatsächlich, seelenruhig und ohne über Bord zu kippen. Ich bin schon froh, dass mir keine Zeit fürs Frühstück geblieben war; ich weiß ja nicht mal, ob mein Magen seetüchtig ist.
Der Tag bricht an, der Capitaine hinter mir drosselt den Motor, sucht die richtige Stelle über einem Riff, dann wirft sein Kollege vorn im Bug einen Anker aus. Hier liegen wir in hoher Dünung, es schaukelt nicht minder, ich halte mich verkeilt und schaue den drei Jungen zu, die ihre Handleinen auswerfen, sie prüfend mit heftpflasterbewehrten Fingern führen und immer wieder einziehen, um die Köder an den Angeln zu ersetzen, Stücke von Fischen von gestern. Selten beißt einer an. »Marée haut«, sagt Banda, der mir gegenübersitzt, und zuckt die Achseln, als möchte er sich von vornherein entschuldigen: Bei Flut ist nicht gut fischen.
Tatsächlich tut sich auch bei den zwei anderen Fischern wenig. Nur Banda hat heute Glück; an seiner Leine mit acht Haken zappelt hin und wieder ein Fisch. »Tu veux essayer?«, fragt er mich und hält mir seine Leine hin. Ich winke ab. »Erklär mir lieber genau, wie du’s machst.« Er lässt die Leine über seinen Finger weggleiten, wartet, wartet, zieht kurz an – »Siehst du?«, sagt er mehr mit den Fingern als mit seiner Stimme. »Bei manchen Fischen musst du die Leine gehen lassen, wenn sie anbeißen, bei anderen hingegen musst du sogleich anziehen, damit sie hängen bleiben.« – »Und woher weißt du, welche Art von Fisch du an der Angel hast?« Er zuckt bloß wegwerfend die Achseln, soll wohl heißen: »Ist doch klar, Mann, ich mach ja nichts andres seit meiner Kindheit!« Und seit Generationen suchen sie täglich dieselben Plätze auf, kennen ihre Riffe genau, auch wenn sie sich heutzutage mittels GPS versichern, dass sie am rechten Ort angelangt sind.
Mein Hintern schmerzt vom langen Sitzen auf demselben Platz; doch meine Aufmerksamkeit ist meist bei Banda, der etwas Französisch spricht und es gern anwendet, derweil die anderen beiden stumm bleiben. Ich erfahre, dass die drei Cousins seit Jahren zusammen fischen. Ob sie ihre Arbeit lieben? »Travail? Ce n’est même pas un travail de merde!« Nicht mal eine Scheißarbeit sei das, lausig bezahlt, und Fische gebe es ja kaum mehr welche, weil die Spanier, die Japaner und die Koreaner das Meer im großen Stil leer fischen. Oder für sich leer fischen lassen, denke ich und sehe vor mir das Bild auf der kurzen Überfahrt mit der Fähre von der Insel Gorée zurück nach Dakar vor einem halben Jahr, als ich zum ersten Mal hier war: Bis zum Horizont trieben Tausende tote Fische auf dem Wasser, äußerlich unversehrt und frisch. Als des Rätsels Lösung traf der Blick wenig später auf ein koreanisches Fabrikschiff vor Anker. Hierher verkauften Pirogen ihren Fang, und von hier wurden unzählige Fische weggeworfen, weil sie irgendwelche Kriterien nicht erfüllten. »Mit diesen Fischen könnten doch Tausende ernährt werden«, hatte ich zu unserem Guide gesagt, und nach dessen höflichem Nicken nachgehakt: »Warum lässt eure Regierung das denn zu?« – »Wir sind eben ein armes Land«, meinte er leise, »und wir brauchen unbedingt Devisen …«
Doch es geht noch schlimmer: Ein halbes Jahr später, bei meinem dritten Aufenthalt im Senegal, erfahre ich, dass bessergestellte Nationen ihre Fischgier sogar devisenfrei zu stillen verstehen. Um Kosten zu sparen, holen Fabrikschiffe aus Südkorea (und wer weiß, woher sonst noch) einheimische Fischer samt deren Pirogen an Bord, fahren entlang Westafrika von Mauretanien bis Angola, ankern vor fischreichen Riffen und schicken die Pirogen aus, die in Senegal und anderen westafrikanischen Ländern freien Zugang zur Fischerei haben, egal, aus welchem Land sie kommen, und egal, wohin sie ihren Fang verkaufen. Jedenfalls bis damals, 2005, war das noch so, denn die traditionellen Fischereirechte waren nicht auf Schiffe aus Europa oder Asien ausgelegt. Und die Pirogenfischer aus dem Norden Senegals hatten nicht damit gerechnet, dass jenes koreanische Fabrikschiff, dem sie vor Angola so reiche Beute gebracht hatten, sie noch einmal zum Riff aussenden würde, um sich dann plötzlich auf und davon zu machen und sie in fernen Gewässern und ohne Lohn zurückzulassen. Allerdings lerne ich auch, dass einheimische Fachleute den Raubbau an den einst reichen Fischbeständen vor Senegals Küsten nicht mehr nur dem Verscherbeln von Fischereirechten an ausländische Industrieflotten anlasten, sondern auch der Befischung durch einheimische Pirogen, deren Zahl zunimmt, weil Menschen dürrer werdendes Acker- und Weideland in der Hoffnung verlassen, beim Fischfang wenigstens noch etwas zu verdienen, auch wenn sie dafür weder ausgebildet noch angemessen ausgerüstet sind.
Obendrein, sagt Banda und holt mich aus meinen Gedanken zurück, obendrein sei ihr Job extrem gefährlich; hin und wieder kentere eine Piroge und die Fischer ertränken. »Keine Schwimmwesten?«, frage ich, und gleichzeitig wird mir bewusst, dass ich selber ohne Schutz hier draußen hocke, in voller Kleidung und engem Ölzeug, das ich im Wasser nicht mehr vom Leib brächte … »Non, pas de gilets de sauvetage«, keiner hat das hier, es fehle schlicht das Geld dazu. Tatsächlich, erfahre ich ein halbes Jahr später – erstaunt darüber, dass ich gleich beim Betreten der alten Fähre nach Foundiougne ermahnt werde, mir eine Schwimmweste anzuziehen –, dass das Tragen dieser Rettungswesten im Senegal tatsächlich bei jeder Fahrt auf dem Wasser Pflicht sei. Was fehlt, sind die Schwimmwesten selbst. Unsere KollegInnen von einer senegalesischen NGO hatten sich darum die Mühe gemacht, die lokale Produktion von Schwimmwesten an die Hand zu nehmen. Nach drei Serien hatten sie allerdings wieder aufgeben müssen, da sich im ganzen Land kein Material für die Schwimmhilfen mehr auftreiben ließ. Stattdessen erbarmte sich China (egal welches; beide beglückten das Land mit Projekten und schielten nach dessen Rohstoffen) und schenkte Senegal Abertausende von Schwimmwesten, die nun zu 5000 hiesigen Franc verkauft werden. Das entspricht fünf einfachen Mittagessen in einem lokalen Restaurant. Die Fischer aber tragen weiterhin keine dieser gilets chinois; vielleicht ist ihnen die Widmung auf der Rückseite nicht ganz geheuer: »Amitié de la République de Chine (Taiwan).« Wie auch immer; eines hat die Schenkung mit Sicherheit bewirkt: Die heimische Produktion der Lebensretter bleibt in weite Ferne gerückt.
Kurz, für Banda mag es weniger beschämend und jedenfalls einfacher gewesen sein, das Abhandensein von Schwimmwesten mit dem landesüblichen Mangel an Geld zu erklären. Ob er denn im letzten Jahr nicht EUR 100 erhalten habe? »Von wem?« – »Nun, in ganz Afrika bekommt Senegal am meisten Entwicklungshilfe, USD 100 pro Kopf und Jahr!« Er stutzt, lacht dann: »Non, jamais vu ça, mir hat noch keiner was gegeben, und ich kenne keinen, der was gekriegt hätte. Aber wenn ich mal Geld hab, hau ich ab. Emigration weißt du?«
»Wohin denn?«
»Italien, Spanien …«
»Du kommst heute höchstens noch bis Marokko; dort hat Europa einen hohen Zaun aufrichten lassen!«
»Nun, ich werd’ mich durchschlagen …«
»Und wenn: Bei uns ist nicht nur das Klima zu kalt für dich; da wartet keiner auf dich!«
»Ich kenn aber einen, der hat’s geschafft und hat jetzt einen tollen Job in Amsterdam!«
»Nun, da hat einer Glück gehabt, einer von Zehntausenden. Aber wo fühlst du dich denn zu Hause?«
»Na, hier, ist doch klar!«
»Warum willst du denn weg?«
»Ich will was andres machen als fischen; keiner von uns Jungen will noch fischen.«
»Was wär