fair-fish. Billo Heinzpeter Studer
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу fair-fish - Billo Heinzpeter Studer страница 5
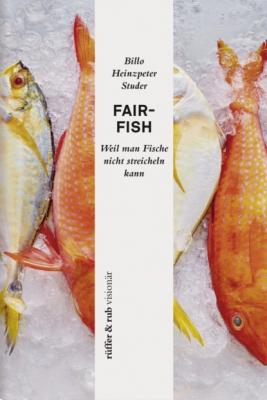 »ad interim«
»ad interim«
Meiner Einschätzung nach hätte dies das Ende der kleinen Organisation bedeutet; lange überlegte ich hin und her, und entschloss mich endlich, Lea Hürlimann anzubieten, dass ich die Geschäftsleitung für zwei Jahre übernehmen und in dieser Zeit eine geeignete Nachfolge suchen würde. Sie hatte darauf gehofft und, wer weiß, gar geahnt, dass ich länger bleiben würde. Tatsächlich hat mich diese neue Aufgabe derart herausgefordert und gepackt, dass ich mich ihr die nächsten 16 Jahre widmete. Ich mietete ein Büro in St. Gallen, zog dort mit der KAG ein und wurde vom Redaktor der lokalen Zeitung als einer »mit dem langen Atem« porträtiert – noch jemand, der vor meiner Zukunft mehr wusste als ich selbst … Wenig später zog ich mit einer neuen Partnerin zusammen, die vegetarisch aufgewachsen war. »Alles klar«, sagte ich, »dann aber konsequent!«, denn auch für Eier und Milch werden Tiere genutzt und, wenn zur Produktion unbrauchbar, einfach getötet. Fortan ernährten wir uns vegan, auch wenn dies das Problem der Pflanzenproduktion ungelöst ließ. Einzig ein Ei testete ich hin und wieder, wenn es einer Reklamation wegen zu uns gelangte. Und ich lernte, beim Besuch auf dem Hof eines »unserer« Bauern nicht auf veganer Kost zu bestehen, wenn mir Produkte des Hauses zum Genuss offeriert wurden – intellektuell konnte die Familie meine Haltung zwar nachvollziehen; aber emotional blieb etwas Ungutes hängen, und das wollte ich vermeiden. Der Kompromiss fiel mir umso leichter, als ich meinen Ernährungsstil ohnehin nicht wie ein Werbeschild vor mir hertrug; Missionieren war mir fremd, Kampagnen lagen mir näher: Wer mag, macht mit.
In dieser Zeit wuchs die Organisation: Wir lancierten Kampagnen gegen Gentechnologie, zu BSE (Rinderwahn) sowie für strengere gesetzliche Vorschriften an die Nutztierhaltung und wir verbesserten die eigenen Richtlinien und Kontrollen. Und plötzlich wollten sich der KAG weit mehr Bauern und Bäuerinnen anschließen, als wir begleiten konnten; LandwirtschaftsberaterInnen hatten ihnen Direktvermarktung als zweites Standbein und die KAG als Mittel dazu empfohlen. Um den unerwarteten Ansturm in Grenzen zu halten, verschärften wir unsere Richtlinien; so verboten wir etwa den »Kuhtrainer«, einen Elektrobügel über dem Rist der Kühe, mit dem sie gezwungen werden, zum Koten einen Rückschritt zu machen, damit die Einstreu sauber bleibt, wir stellten gleichzeitig die Weichen Richtung Laufstall und verlangten zudem, dass fortan ein Betrieb alle seine Tierarten nach KAG-Richtlinien halten muss, um das Zertifikat zu behalten.2
Einseitiger Gesellschaftsvertrag
Eines meiner Vorbilder in jener Zeit war die britische Ethologin Marthe Kiley-Worthington, die ein Kompensationsprinzip als Basis für eine akzeptable Nutztierhaltung vertrat: Ziel müsse sein, für die Tiere eine Lebenssituation zu schaffen, die sogar besser sei, als wenn sie in der Wildnis lebten, wo sie nicht immer Futter und Wasser fänden, niemand ihre Wunden pflege oder sie vor extremen Wetterbedingungen schütze – dann erst sei es gerechtfertigt, ihre Produkte zu nutzen und sie gar zu töten. Eine Art Gesellschaftsvertrag zwischen Mensch und Tier, ein Gedanke, der sich leider als Selbsttäuschung entpuppt, da die Tiere ja nicht aus eigenen Stücken zustimmen können, sondern nur durch die ungefragte Fürsprache von TierschützerInnen.
Nichtsdestotrotz hielt ich es für richtig und wichtig, innerhalb der Realitäten der Landwirtschaft dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse der Tiere respektiert werden, insbesondere das Bedürfnis, sich ihrer Art gemäß verhalten zu können. Wegweisend für mich war unter anderem der Forschungsansatz des Schweizer Ethologen Alex Stolba, der in den 1970er- und 1980er-Jahren das Verhalten von ausgewilderten Schweinen minutiös beobachtet und daraus Schlüsse für deren artgerechte Haltung in einem Stall gezogen hatte. Das ist von einem natürlichen Schweineleben auf der Weide und im Wald zwar weit entfernt, bringt aber in einem einmal gebauten Stall während dessen Amortisationszeit immerhin Vorteile für die darin eingesperrten Tiere. Auch ich blieb also dem einseitigen Gesellschaftsvertrag verhaftet; manchmal hätte ich mir einfach gewünscht, dass die Tiere selber sagen könnten, was sie wollen und was nicht. Am meisten wünschte ich mir das für die Hühner, die kleinsten und schwächsten unter den landwirtschaftlichen Nutztieren, die üblicherweise zu Hunderten gezählt werden und deren Individualität am wenigsten beachtet wird; die Idee, sie in Käfigbatterien einzusperren, zeugt davon.3
Plötzlich auch noch Fische
Nach einer Pressekonferenz im Jahr 1997 bat mich ein Herr um ein Gespräch. Er stellte sich als Berater der damaligen Schweizer Detailhandelskette Usego vor, die, ähnlich wie bereits Migros und Coop, eine Linie mit Bio-Lebensmitteln einführen wollte. Hierfür war er unter anderem auf der Suche nach Fischen aus Schweizer Zucht und wollte wissen, ob die KAG Richtlinien hierfür entwerfen könnte. Fische haben mich stets fasziniert und zugleich erbarmt, weil sie wie die Hühner gering geachtet und nur als Masse wahrgenommen werden; zudem hatte ich eine Schuld abzutragen: Obwohl meine Eltern damals den Wunsch von uns Kindern nach einem Haustier immer ausgeschlagen hatten – Vater mochte keine Katzen, und einen Hund würde am Ende immer Mutter Gassi führen müssen –, waren sie eines Tages mit einem Aquarium und ein paar Fischen darin vom Einkauf zurückgekehrt; Fische machen keinen Dreck und keinen Lärm und sind leicht zu halten. Oder so dachten sie. Es war dann nicht lange gut gegangen; niemand in der Familie hatte die leiseste Ahnung von Fischhaltung und die Tiere haben nicht lange überlebt.
Also los, Richtlinien für die Fischzucht mussten her! In meiner Freizeit suchte ich nach Literatur über die Bedürfnisse und das Verhalten von Fischen und begann, auf der damals sehr dünnen Grundlage an gesicherten Erkenntnissen mit Skizzen für eine tier- und umweltfreundliche Aquakultur. Inzwischen war ich mit einem Kollegen des WWF Schweiz in Kontakt gekommen, der an der Entwicklung eines Standards für nachhaltige Fischerei beteiligt war, der zwei Jahre später als MSC-Siegel bekannt wurde. Zu uns stieß ein Kollege von Bio Suisse, der die Aufgabe hatte, Regeln für die Bio-Fischzucht zu erarbeiten. Ein Jahr lang arbeiteten wir zu dritt an Richtlinien für Fang und Zucht, bis meine Kollegen von ihren Organisationen zurückgerufen wurden; der WWF wollte sich nicht um die Zucht kümmern, die Bio Suisse nicht um den Fang. Wieder alleine, stellte ich die Richtlinienentwürfe fertig und ließ sie unter Mithilfe von Studierenden der oberen Semester und von Praktikern in zwei Runden kritisch beurteilen. Den Schlussbericht mit dem Titel »Fisch ist kein Gemüse« unterbreitete ich den fünf Tierschutzorganisationen, welche die Arbeit finanziell unterstützt hatten, und schließlich der KAG, für die ich die Richtlinien erstellt hatte. Der Entscheid des KAG-Vorstands war ein Dämpfer für mich, aber rückblickend wohl weise: Die Organisation habe schon genug unterschiedliche Tierarten zu kontrollieren, eine weitere wäre zu viel. Tatsächlich handelt es sich aber um weit mehr als nur eine Tierart: Kommerziell werden weltweit Fische von mehreren Hundert Arten gefangen oder gezüchtet, allein in der Schweiz sind es mindestens zwei Dutzend.
Wir waren schon zu weit vorangekommen in unserer Arbeit, und es erwarteten schon zu viele etwas von uns. Ähnlich wie einst Lea Hürlimann fühlte ich mich gedrängt, aus dem Angefangenen etwas Richtiges zu machen; also Schluss mit einem kleinen Projektlein nebenher. Den fünf Organisationen, die die Arbeiten bis dahin begleitet und finanziert hatten, schlug ich vor, einen Verein mit dem Namen fair-fish zu gründen. Zu Beginn des Jahres 2000 war es schließlich so weit: Die VertreterInnen von Tierschutzbund Zürich, Verband Tierschutz-Organisationen Schweiz (VETO), Zürcher Tierschutz, Aargauer Tierschutz und von Bioterra gründeten den Verein fair-fish als Fachstelle für Tierschutz bei Fischen, nahmen im Vorstand Einsitz und beauftragten mich mit der Leitung der Fachstelle. Wenig später stieß als Mitträger auch der Schweizer Tierschutz (STS) hinzu, der unsere Arbeiten zuvor schon verfolgt hatte.
Wäre es besser, wenn ich nur noch einheimische Fische kaufe? [→ Kapitel »Welchen Fisch kann ich noch essen?«]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте