Punkt - Punkt - Sommer - Strich. Roy Jacobsen
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Punkt - Punkt - Sommer - Strich - Roy Jacobsen страница 3
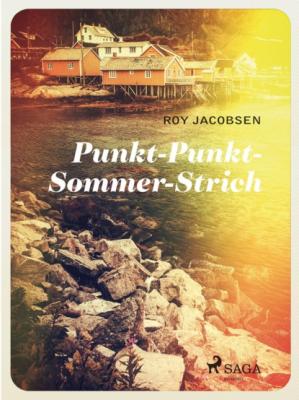 idyllischen Häuslein dahinspazieren (was mich betrifft, nett angeschwipst), denke ich noch einmal gründlich über unsere seltsame Ehe nach, die ich zeitweise als leicht langweiligen Roman von Alain Robbe-Grillet betrachtet habe, als Lebensform, die ich nur ertrage, um zu sehen, wie der Schluß ausfallen wird, ohne je so weit zu kommen. Ich spiele ganz leicht mit dem Gedanken, unseren Aufenthalt hier unten dauerhaft werden zu lassen, denn wie alles andere in meiner politischen Karriere (die peinlich genau mit meiner persönlichen und beruflichen übereinstimmt) war auch der Umzug in den Norden nur halbherzig. Ich gab nach, als Katrine nach dem Examen erklärte, daß unser nördlicher Landesteil »uns braucht«, bewußte Lehrerinnen wie sie und gesellschaftlich engagierte Schriftsteller wie mich. Und das ist ja auch ein bißchen schmeichelhaft. Ich fand es dann auch sehr schön im Norden, in den ersten drei, vier Jahren, ehe mir so langsam bewußt wurde, daß ich diesmal wohl zu weit gegangen war. Ein Gefühl, das von da an immer nur stärker wurde, so daß ich mich in finsteren Momenten frage, ob ich daraus eine richtige Bruchsituation machen und also in einem Aufwasch die Scheidung einreichen soll. Aber der Gedanke, in Oslo zu wohnen, wo ich am liebsten wohnen würde, während die Kinder in Tromsø wohnen und wachsen, ist unerträglich, selbst in finsteren Momenten. Außerdem habe ich auch meine lichten Momente, in denen ich mich auch nach dem Süden sehne, aber dann auf aufmunterndere Weise, und dann will ich auch Katrine bei mir haben. Deshalb sage ich, als wir noch ein weißes Häuslein mit Fensterchen und dressiertem Vorgarten passieren, zwischen dem weißen Holzwerk und dem ebenso weißen Lattenzaun:
idyllischen Häuslein dahinspazieren (was mich betrifft, nett angeschwipst), denke ich noch einmal gründlich über unsere seltsame Ehe nach, die ich zeitweise als leicht langweiligen Roman von Alain Robbe-Grillet betrachtet habe, als Lebensform, die ich nur ertrage, um zu sehen, wie der Schluß ausfallen wird, ohne je so weit zu kommen. Ich spiele ganz leicht mit dem Gedanken, unseren Aufenthalt hier unten dauerhaft werden zu lassen, denn wie alles andere in meiner politischen Karriere (die peinlich genau mit meiner persönlichen und beruflichen übereinstimmt) war auch der Umzug in den Norden nur halbherzig. Ich gab nach, als Katrine nach dem Examen erklärte, daß unser nördlicher Landesteil »uns braucht«, bewußte Lehrerinnen wie sie und gesellschaftlich engagierte Schriftsteller wie mich. Und das ist ja auch ein bißchen schmeichelhaft. Ich fand es dann auch sehr schön im Norden, in den ersten drei, vier Jahren, ehe mir so langsam bewußt wurde, daß ich diesmal wohl zu weit gegangen war. Ein Gefühl, das von da an immer nur stärker wurde, so daß ich mich in finsteren Momenten frage, ob ich daraus eine richtige Bruchsituation machen und also in einem Aufwasch die Scheidung einreichen soll. Aber der Gedanke, in Oslo zu wohnen, wo ich am liebsten wohnen würde, während die Kinder in Tromsø wohnen und wachsen, ist unerträglich, selbst in finsteren Momenten. Außerdem habe ich auch meine lichten Momente, in denen ich mich auch nach dem Süden sehne, aber dann auf aufmunterndere Weise, und dann will ich auch Katrine bei mir haben. Deshalb sage ich, als wir noch ein weißes Häuslein mit Fensterchen und dressiertem Vorgarten passieren, zwischen dem weißen Holzwerk und dem ebenso weißen Lattenzaun:
»Was sagst du zu der Idee, wieder in den Süden zu ziehen, Katrine?«
Ich spüre ihren Blick, sie schluckt ihre Empörung hinunter und macht statt dessen Platz für eine nüchterne Frage:
»Gefällt es dir nicht mehr im Norden?«
»Tja, das weiß ich wirklich nicht.«
»Davon hast du nie etwas erzählt.«
(Wir sind also wieder in Gang.)
»Mir ist das erst heute abend so richtig bewußt geworden«, murmele ich und bin dieses eine Mal zufrieden mit meiner Lüge, ich strecke sogar die Hand aus und zeige ihr die weißen Häuser und den Weg hinab zum Fjord, zum Oslofjord, der in seiner schwarzen Fläche einige wenige Lichter von den Häusern auf dem anderen Ufer widerspiegelt, ein Feuer in der Dunkelheit. Wir hören ferne Musik, Stimmen, Lachen, ein träges Boot, Sommergeräusche, die heute besonders stark auf uns wirken, nach dem abrupten Übergang von beißendem Wind und standhaftem Winter.
»Das müssen wir uns auf jeden Fall gut überlegen«, sagt Katrine. »Was ist mit den Kindern?«
»Die haben ja noch nicht mal den Akzent von da oben aufgeschnappt, die werden sich hier im Handumdrehen eingewöhnen.«
Wenn man diesen Satz genau untersucht, was Katrine tut, dann wird man sehen, daß er durchaus eine Spur von Herablassung unserem nördlichen Landesteil gegenüber enthalten kann, vor allem, wenn man noch dazu meine Stimmlage mit in Betracht zieht, die nicht nur der hohen Promille zugeschrieben werden kann. Aber Katrine lächelt nur und geht zu einem Fliederbusch, dessen selbstleuchtende Blüten über dem Weg hängen und uns in einen Duft einhüllen, der mir, wie gesagt, seit neun Jahren fehlt. Sie blickt sich um, wie ein Dieb in der Nacht, stellt sich auf Zehenspitzen, zieht einen Zweig zu sich hinunter und bricht ihn ab, zu meiner großen Überraschung, sie bricht bei wildfremden Menschen im Garten einen Zweig ab – das muß Katrines erster und einziger Diebstahl auf dieser Welt sein –, lächelt verschmitzt und reicht ihn mir mit einem Kuß auf den Mund:
»Riech mal, wie der duftet!«
»Der duftet einfach wunderbar. Was ist in dich gefahren«, füge ich nüchtern hinzu.» Zu tief ins Glas geschaut?«
»Wahrscheinlich. Außerdem liebe ich dich.«
»Du liebst mich doch sonst nicht so, daß ich das merke, Katrine.«
»So siehst du uns also?«
»Ja, und eigentlich gefällt mir das. Gefühle machen nur Ärger.«
»Jetzt hör aber auf!«
Ich lächele und stecke mir meinen frischerworbenen und arg unverdienten Liebesbeweis ins Knopfloch, und wir schlendern noch tiefer in diese unendliche Sommernacht hinein, zum Hafen hinunter, wo die Leute vor einem Restaurant auf dem Anleger sitzen und Wein trinken, schön angezogene Menschen, die Frauen in Weiß, die Männer in heller, beiger und grauer Freizeitkleidung. Eine Bande von Jugendlichen lärmt unten am Strand herum, teilweise an Bord eines Cabincruisers, teilweise im Wasser. Und auf einem Steg sitzen zehn, zwölf Kinder und lassen die Füße baumeln. Wir sehen auch unsere Gören.
»Sollen wir sie stören oder lieber ein Glas Wein trinken?« frage ich.
»Wir stören sie doch nicht.«
»Dann trinken wir ein Glas Wein.«
»So war das nicht gemeint.«
»Ich weiß, wie das gemeint war, meine Liebe, du meinst immer dasselbe. Weißwein?«
Wir setzen uns an den einzigen freien Tisch auf der Pontonbrücke vorm Restaurant und bestellen bei einer süßen Kleinen, die der Restaurantbesitzer aus unerfindlichen Gründen in ein österreichisches Dirndl gesteckt hat, Trittenheimer Altärchen. Ich lasse meine Frau den Wein kosten, auch das ein altes Ritual. Katrine, die es in früheren Zeiten und im Namen des Fortschrittes durchgesetzt hat, daß sie im Restaurant die Vorkosterin macht. Jetzt lächelt sie nur.
»Nein, probier du, ich merke ja doch nicht, ob er gut ist.«
»Der ist gut«, sage ich ohne zu kosten zum Dirndl, denn ich habe es auch nie gewagt, eine geöffnete Flasche Wein in die Küche zurückgehen zu lassen. »Schenken Sie ein.«
Wir trinken, stoßen auf den Sommer und auf meinen Roman an.
»Wie läuft es eigentlich?« fragt Katrine und bringt die Falte zwischen ihren dunklen Augen an, die Falte, die für dieses eine Thema reserviert ist: für die Schreibprobleme des Gatten.
»Zum Teufel. Aber das macht nichts.«
»Das meinst du doch nicht im Ernst?«
»Doch, aber das habe ich schon oft gemeint und dann doch noch was geschafft. Und das wird diesmal wohl auch so sein.«
»Dir fehlen doch bloß noch zehn, zwanzig Seiten, stimmt das nicht?«
»Mir fehlt der Abschluß, und ein Abschluß kann zwei oder auch sechzig Seiten lang sein, es kommt darauf an. Ein Abschluß kann kurz oder endlos sein, Hauptsache, er ist gut; daß der Abschluß gut ist, ist wichtiger als der ganze Rest.«
»Und was ist ›ein guter Abschluß‹?«
»Tja, wenn ich das wüßte!«
Ich möchte an dieser Stelle zugeben, daß ich die Sorte Schriftsteller bin, die sich durch achtzig bis hundert Seiten hindurchstolpert, aufgrund von Einfällen und einer leicht vagen Idee (sie muß sogar »vage« sein), daß mir in der Regel unterwegs neue Aspekte einfallen, nach und nach auch in bezug auf die vorangegangenen Seiten, so daß sich daraus eine Art Architektur ergibt, ein geschichtetes Bauwerk, an dem ich weiter herumstapele – bis ich leer bin. Wenn ich dann leer bin (und den ganzen Mist einfach satt habe), geht mir immer nach einer Weile verwirrter Dürre ein Licht auf. Und deshalb haben alle meine Romane einen leuchtenden Schluß, oder eine »Pointe«, könnte ich wohl sagen, das Licht, das jetzt