Seelenzerrung. Winfried Thamm
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Seelenzerrung - Winfried Thamm страница 7
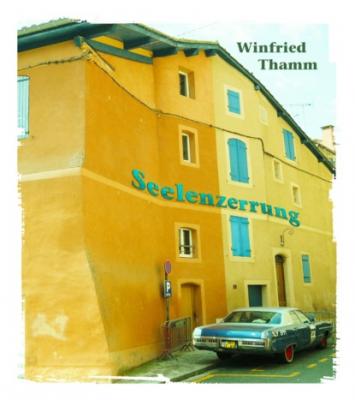 style="font-size:15px;"> „Wieso?“
style="font-size:15px;"> „Wieso?“
„Die Musik, sie lebt davon. Ohne Dynamik keine Musik. Sie verstehen?“
„Jetzt sagen Sie das auch schon.“
„Was?“
„Sie verstehen. Ich sage das andauernd, wenn ich nervös bin. Sie …“
„… verstehen?“, ergänzt sie. Beide lachen auf. Das Eis ist gebrochen. Sie schaut ihn so an, dass ihm ganz anders wird.
Daraufhin erzählt Kleinmann von seinen Brücken und Gebäuden, die er begutachtet und prüft auf Konstruktion und Material, auf Druck und Zug, auf Dichte und Haltbarkeit, auf Sicherheit und Langlebigkeit. Er arbeite nicht an Neubauprojekten, sondern kümmere sich um den Erhalt von vorhandener Bausubstanz. Ja, er habe sich ganz der Bewahrung und der Stabilität verschrieben. Das sei seine berufliche Aufgabe. „Aber das finden Sie bestimmt ziemlich langweilig?“
„Ganz und gar nicht. Das ist doch eine wunderbare und sinnvolle Arbeit“, erwidert Hanna und Kleinmann lächelt verlegen. „Damit kann ich nicht dienen. Was ich mache, ist eigentlich völlig sinnlos. Ich produziere Töne mit ein paar Pferdehaaren auf vier Drahtseilen über einem Holzkasten. Und im nächsten Augenblick sind sie schon wieder weg, die Töne. Verweht, verschwunden, vergessen.“
Kleinmann lacht auf: „Das ist gut, das ist sogar super formuliert: Pferdehaare, Drahtseile, Holzkiste! Ha!“
„Ja, ist doch so! Und nach dem Konzert bleibt nichts. Alles verklungen. Die Zuhörer sagen: schön. Sie gehen anschließend in eine Bar, reden über ihre Familien, ihre Jobs und ihre Autos und betrinken sich. Oder auch nicht, keine Ahnung. C’est ca!“, sagt sie und schürzt dabei kokett ihre Lippen.
„Aber Frau Waldau, was Sie mir erzählen ist ein Cocktail aus Fishing-for-compliments und Understatement. Sie sind Kulturschaffende und wissen das! Sie machen, schätze ich, großartige Musik auf hohem Niveau, bereisen fremde Länder, treffen interessante Menschen, sind weltgewandt. Ist das nicht großartig?! Darum beneide ich Sie!“
„Ja, ja, ich weiß. Ich mach’s ja auch gerne. Oder besser gesagt: Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gerne mache. Ich kann ja auch nichts anderes. Will auch nichts anderes. Die Frage stelle ich mir gar nicht mehr. Ja, das mit der Kultur stimmt schon, ist aber sehr abgehoben, sehr am Leben vorbei, sehr elitär. Aber da bin ich wie Sie, ich bewahre auch. Ich spiele nichts Neues, nichts Modernes. Heute kann man anscheinend keine Musik mehr komponieren, die sich mit den alten Meistern messen kann. Das klingt arrogant, aber ich sehe das so. Und wenn ich diesen Mozart, Haydn, Bartók, und wie sie alle heißen, nicht mehr spielen könnte, wäre ich tot.“
Sie streicht sich über ihre Finger und lächelt. Kleinmann findet das ein bisschen selbstverliebt. Er würde sie gerne einmal halten, diese Cello-Hände. Sie schaut wieder so und er schaut genauso zurück.
Und dann erzählt sie von dem Schwebezustand nach den Konzerten, von dieser Unwirklichkeit der Bühne, von den immer gleichen Gesprächen mit Kulturdezernenten und Konzertmanagern, von dem Konkurrenzkampf und vom Üben, Üben und nochmals Üben. Da sei kein Platz für Ehemann, Kinder, Familie. Wenn es keine Handys gäbe, hätte sie auch keine Freunde mehr. Nur ihre beste Freundin treffe sie regelmäßig. „Diese Solotourneen machen einen fertig. Mit immer anderen Musikern proben, auftreten und dann ab ins Hotel: Das ist Isolationshaft. Das nervt. Da wäre ich manchmal lieber Statiker“, lacht sie und wirft Kleinmann diesen koketten Blick zu.
Er returniert ihn und sagt: “Und da bin ich jetzt ihr Seelennotstopfen?“
„Ja, so gesehen“, gibt sie zu.
„Ach wissen Sie, es ist doch schön, wenn ein Not-stopfen auf eine Seele trifft, die ein Loch hat, oder?“
„Sind Sie jetzt nicht beleidigt?“
„Nein, mir tut das gut! Sonst liegt meine Seele zuhause auf der Couch und wartet. Und wenn ich dann spät nach Hause komme, ist sie eingeschlafen.“
„Das haben Sie schön gesagt!“, flüstert sie und schenkt ihm ein ehrliches Lächeln. „Wenn ich noch einmal auf die Welt käme, würde ich …“, sie überlegt einen Moment und fährt fort: „Schreiner werden. Möbel bauen, das fände ich toll.“
„Ach, hören Sie auf. Ich weiß doch, was Sie dann bauen würden: ein Cello nach dem anderen. Nichts als Holzkästen mit Drahtseilen drauf!“ Beide lachen hell auf vor Vergnügen.
„Ich heiße Guido, vielleicht sollten wir uns … darf ich dich zu einem Getränk Ihrer, äh, deiner Wahl einladen? Es wäre mir eine echte Freude! So als … Seelennotstopfen. Wir wär’s mit ’nem Du?“, stammelt er. Woher Kleinmann den Mut genommen hat, weiß er nicht, aber er grinst über beide Ohren.
„Ich bin Hanna. Das wurde aber auch Zeit! Und … ich liebe Notstopfen!“ Und wieder schaut sie so, dass es Kleinmann ganz anders wird.
So trinken sie Rotwein, erzählen aus ihren Leben, von ihren Träumen und versäumten Gelegenheiten, rücken zusammen, schauen nicht auf die Uhr, trinken mehr Rotwein, bestellen Erdnüsse, sind unvernünftig, lachen viel, sind auch ein bisschen traurig, trinken als letztes einen Calvados, gehen gemeinsam zum Aufzug, steigen auf der gleichen Etage aus, stehen vor ihrer Zimmertür, als Kleinmann sagt:
„Auf eine so berühmte und ach so schöne Cellistin sollte jemand aufpassen, dass sie im Schlaf nicht plötzlich in den Himmel fliegt. Das wäre ein großer Verlust für die Menschheit. Und ich würde mich da gerne als diesen jemand anbieten.“
Sie stehen ganz nah beieinander. Er riecht ihr Haar, sieht den Glanz in ihren smaragdgrünen Augen, den Schwung ihrer feuchten Lippen und glaubt, noch nie im Leben eine so schöne Frau gesehen zu haben. Sie schaut in das Indigoblau seiner Augen wie in einen Nachthimmel, findet in seinem Lächeln die Ahnung eines kleinen Jungen, der träumt, und riecht seinen Rotwein-Atem, mit einem Hauch Calvados. Sie streicht ihm durchs Haar, küsst ihn zart auf den Mund und sagt:
„Ach, Guido, lass mal sein. Schön wär’s, aber wir machen jetzt mal keinen Quatsch. Und übrigens: Der blasse Streifen auf deinem Ringfinger steht dir nicht. Zieh den Ring drüber.“
So schenkt sie ihm ein letztes Lächeln und lässt ihn stehen.
Wir müssen leider draußen bleiben
Es klopft.
Es klopft an der Tür.
Es klopft an der Tür des alten Bruchsteinhauses.
Die dicken Mauern halten die eisige Kälte des Winters draußen. Das Thermometer zeigt vier Grad unter null.
Es klopft an der Tür des alten Bruchsteinhauses, das ganz einsam an der Landstraße steht, mitten in der Natur am Ufer der Ruhr zwischen Essen-Werden und Kettwig.
Es klopft an der schweren Tür des Hauses, in dem Herr Dr. jur. Arnold Overbeck im behaglich warmen Wohnzimmer sitzt. Er genießt seit drei Jahren seinen Ruhestand, der pensionierte Richter. Kurz vor siebzig macht er noch was her mit seinem gepflegten grauen Haar, seinem noblen Hausrock alter Schule, trotz später Stunde. Es ist 23 Uhr 43.
Und es klopft.
Es klopft und er will es nicht hören, wünscht sich weg, will woanders sein, wo niemand klopft. Nein, er wünscht das Klopfen weg aus seinem Abend, aus seinem Leben. Er will bleiben, wo er ist, nur